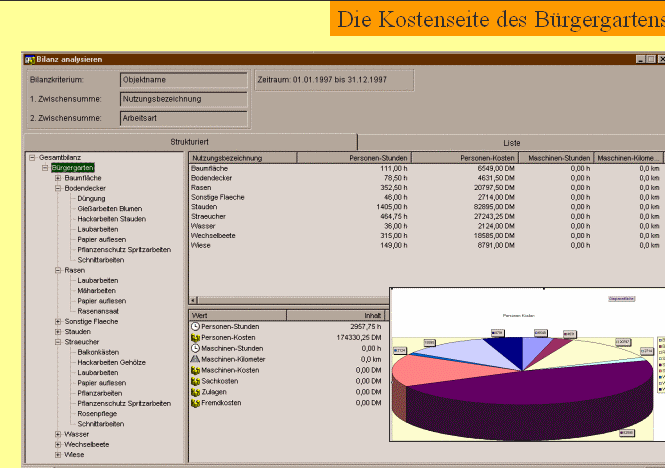1.Einleitung Die Stadt Bietigheim-Bissingen ist eine Kommune mit ca. 40.000
Einwohnern im Großraum Stuttgart, gelegen an der zentralen Entwicklungsachse Stuttgart Heilbronn im mittleren Neckarraum. Die Stadt mit ihren ca. 120 ha Grün, engagiert sich in der überregionalen Grünentwicklung innerhalb der
‚Grünen Nachbarschaft' (loser Zusammenschluß von 7 Städten und Gemeinden mit dem Ziel der gemeinsamen Freiraumgestaltung und Freiraumerhaltung).
Bild1 Luftaufnahme von Bietigheim-Bissingen Für die fundierte Bewirtschaftung des vorhandenen Grünbestandes ist es notwendig, auf eine edv-gestützte
Bestandsdokumentation zurückgreifen zu können. Ein Bestand von ca. 11 000 Bäumen und ca. 120 ha innerstädtischer Grünflächen war somit digital zu erfassen und aufzubereiten.2.Die Historie Als Ausgangspunkt für eine
Grün-Bestandsdokumentation wurden die Themenbereiche Baum und Grünanlagen/Grünflächen festgelegt. Zur Systematisierung des Stadtgebietes wurde auf das Netz der städtischen Rahmenpläne 1:500 vom Landesvermessungsamt zurückgegriffen.
1985 ist das Stadtgebiet beflogen worden und durch eine Firma wurde die stereoskopische Luftbildauswertung für die gesamte Stadt vorgenommen. So entstand unser erstes analoges grafisches Baumkataster. Zusätzlich wurde
mittels eines Datenverwaltungsprogrammes zu jedem Baum ein Datensatz angelegt, in dem solche Sachinformationen wie Baumstandort, Baumnummer, Straße, Baumart und Schäden festgehalten wurden. So entstand unsere
digitale Baumsachdatenverwaltung. Noch vor dem Aufbau des grafischen Baumkatasters und der Baumsachdatenverwaltung war im Jahr 1978 mit der systematischen Erfassung aller Arbeitsleistungen der Stadtgärtnerei
nach Pflegeobjekten und Aufträgen begonnen worden. Grundlage hierfür sind bis heute die Tagesberichte der Vorarbeiter, in denen personenbezogen und täglich alle Arbeiten der Mitarbeiter der Stadtgärtnerei im Sinn eines
vollständigen Stundennachweises gegliedert nach Objekten und Arbeitsarten festgehalten werden. Die Tagesberichte werden seit 5 Jahren auch für die EDV aufbereitet und im städtischen Bauhof mit einer Bauhofsoftware weiterverarbeitet.
Für die in der Stadtgärtnerei benötigte Kosten-Leistungsrechnung waren die Datenaufbereitungen der Bauhofsoftware nicht ausreichend gegliedert, so daß jährlich in mühseliger Handarbeit eine Aufbereitung der Angaben aus den
Tagesberichten zu Quartalsbilanzen vorgenommen wurde. Wie Sie erkennen können, sind seit 1978 in der Stadtgärtnerei schrittweise 3 parallele Datensammlungen
(analoges grafisches Baumkataster, digitale Baumsachdatendatei und manueller Leistungsnachweis) entstanden, die ohne direkte Bindeglieder existierten.
Bild2 Darstellung der 3 historischen Datensammlungen Aus unseren Erfahrungen im Umgang mit großen Datenbeständen zogen wir daher die Schlußfolgerung, daß
nur ein geografisches Informationssystem (GIS) mit der speziellen Ausrichtung für das Baum- und Grünflächenmanagement die Erhaltung und den Ausbau sowie eine sinnvolle Integration unserer 3 Datensammlungen ermöglichen kann. Es galt
also, unsere Daten in ein zu unserer Arbeitsweise passendes GIS zu überführen.Bei der Wahl dieses GIS standen folgende Fachanforderungen der Grünverwaltung und Grünpflege im Vordergrund:
§Für den Bestandsdatenaufbau und die Bestandsdatenpflege: integrierte Handhabung der grafischen und sachdatenseitigen Ausprägung von Bäumen und
Grünflächen
§ Für das Erfassen der Pflegeleistungen: Zuordnungsmöglichkeit der Leistungsdaten zu den
Leistungsebenen (Objekt, Teilobjekt, Anlage, Baum/Grünfläche)§Objektverwaltung: Mechanismus zum
freien Generieren von Objekten (Pflegeobjekte und weitere Leistungsobjekte) §Auskunft und Analyse
: umfassende Such- und Datenaufbereitungsmechanismen für Bestandsdaten, Leistungsdaten und Kontrolldaten §
Quartals-/Jahresbilanzen und Leistungskontrolle als Lenkungsmechanismus: freie Wahl der Parameter für die Kosten-/Leistungsrechnung einschließlich der Möglichkeit der Gewinnung von Kostenkennziffern §Partielle Nutzungsänderungen und Pflegeplanung: Mechanismen zur Planung von Pflegeaufwänden
einschließlich Kostenvorgaben/Zeitvorgaben und Kapazitätseinsatz bis hin zur Auftragsvergabevorbereitung §
Nutzung und Bedienung externer Datenquellen: Integration der digitalen Stadtgrundkarte und Integration des Bauhofverfahrens §Unterstützung der Baumkontrolle: Möglichkeiten zum Führen eines Baumkontrollbuches mit multimedialer Dokumentation von Schäden und Anschluß der Schadenbestimmung an die
Auftragsvergabevorbereitung Kontrollmanagement §
Innerstädtischer Informationsfluß und Bürgerinformation: Integration ausgewählter Ergebnisse der Grünplanung und Grünabrechnung in ein städtisches Informationsnetz (Intranet)
Die spezielle thematische Ausrichtung des GIS auf die Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Stadtgärtnerei schränkte die Auswahl der am Markt angebotenen Systeme sehr stark ein. Wir haben uns dann für das Produkt
InfraGrün, bzw. dessen Vorgängerprodukt GREENBOX, der Firma GLOBUS Informationssysteme GmbH entschieden. 3.Ein neues Arbeitsmittel eine langfristige Konzeption
Vor uns stand nach dieser Grundsatzentscheidung die Frage, was von unserer bisherigen Konzeption ohne Veränderungen in das GIS übernehmbar war und wo neue Wege gegangen werden mußten.
Folgende Entscheidungen wurden 1996 getroffen: §Eine thematische Erweiterung
hinsichtlich Spielanlagen und Grünflächeneinrichtungen sowie hinsichtlich Flächen und Objekten aus dem landwirtschaftlichen Förderprogramm und hinsichtlich der Biotopvernetzung soll erfolgen
§ Die Systematisierung des Stadtgebietes
ist vom Netz der städtischen Rahmenkarten 1:500 auf das Netz der Flurkartenblätter umzustellen, was auch eine Neunumerierung der Bäume erfordert; eine Objektgliederung wird zusätzlich eingeführt§Für die Leistungsabrechnung und Bilanzierung werden das GIS und das Bauhofprogramm gekoppelt §Als digitales Hintergrundbild wird die komplette Flurkarte (soweit verfügbar) vom Landesvermessungsamt übernommen
§Künftige Datenquellen
für die Baum-/Grünflächenaktualisierung werden das Luftbild/Orthofoto, die digitale Flurkarte, Baupläne von Grünanlagen und die terrestrische Vermessung sein §Die Datenerfassung erfolgt in der Regel auf der PC-Technik im Gartenamt, wobei die Grundlagen von Firmen zugearbeitet werden §Leistungsdaten aus der Grünpflege werden absehbar in den Tagesberichtsbögen erfaßt §
Es sollen Methoden der digitalen Erfassung vor Ort
getestet werden, um die Kosten für die technische Ausstattung zu ermitteln und Technologien zu erarbeiten, mit denen die neue Arbeitsweise zur Akzeptanz bei den Mitarbeitern führt und dadurch eine echte Rationalisierung der Datenerfassung ermöglicht
Hardwarebasis ist ein Pentium PC mit 32 MB Hauptspeicher, ein 15" Alpha-Bildschirm und ein 20" Grafikbildschirm sowie ein A0-Digitalisiertisch. 4.Der momentane Stand Das Baumkataster
ist derzeit etwa zu 60 % grafisch und sachdatenseitig erfaßt, wobei aus den Karten des analogen Baumkatasters im GIS die Standorte abdigitalisiert sowie anhand des digitalen Flurkartenhintergrundbildes am Grafikschirm korrigiert und ergänzt wurden. Die vorhandenen digitalen Baumsachdaten wurden bei der Digitalisierung automatisch auf die neue Systematisierungsgrundlage des Flurkartennetzes umnummeriert und in die Sachsätze des GIS übernommen.
Bild 3 Datenbestand im GIS Das Grünflächenkataster
ist derzeit etwa zu 40 % grafisch und sachdatenseitig erfaßt. Hierbei wurden die Grünflächen- und Anlagenbegrenzungen vorrangig anhand des digitalen Hintergrundkatasterbildes am Bildschirm gezogen bzw. konstruiert. Einige Anlagen wurden aus vorliegenden Bauplänen am Digitalisiertisch erfaßt. In Bereichen, in denen absehbar keine digitale Katastergrundlage vom staatlichen Vermessungsamt bereitgestellt werden kann bzw. diese Grundlage nicht ausreicht, laufen z. Zt. Vermessungsarbeiten.
Die digitale Erfassung der Leistungsdaten zu Bäumen und Grünflächen sowie die Erfassung der Baumkontrolle erfolgt im GIS seit Anfang diesen Jahres. Die ausgefüllten Tagesberichte enthalten alle Angaben, die zur
Kosten-/Leistungsrechnung (Bilanzen) und zur Lohnabrechnung notwendig sind. Die zusätzlichen Angaben zur Verrechnung auf interne Haushaltstellen und zur Rechnungslegung an externe Auftraggeber sind in den Bestandssätzen der
betroffenen Objekte enthalten. Die Tagesberichte werden täglich im GIS erfaßt und dort automatisch mit den erforderlichen Codierungen zur Buchung versehen, sowie für eine Übergabetransaktion an das Bauhofprogramm vorbereitet.
Bild 4 InfraGrün Dateneingabe und Bilanzen Die zeitnahe Ergebniskontrolle und die
Ermittlung eigener, zu unseren Objekten passender Kennziffern (Durchschnittswerte zu Stunden und Kosten), sind eines unserer Hauptziele bei der GIS-Einführung gewesen.Zum Jahresende 1998 sollen erstmals die so angestrebten
Ergebnisse einen Überblick über die Aufwendungen der Grünpflege eines Jahres geben (Objekt- und Nutzungsartenbezogen). Hierdurch kann dann die manuelle Zusammenstellung wegfallen, so daß neben der erhöhten Aussagefähigkeit auch
eine Arbeitsersparnis erreicht wird. Auf Grund unserer jahrelangen Kenntnisse im Bereich der Grünbewirtschaftung entstehen durch die Aussagen des GIS natürlich keine vollständig neuen Erkenntnisse, jedoch sehr wohl bei bestimmten
Details eine exaktere Quantifizierung von Sachverhalten und in jedem Falle eine fundiertere Grundlage für einen Objektvergleich nach Nutzungsarten. Unsere Entscheidungen werden insgesamt belegbarer. Dies möchte ich Ihnen
gerne anhand unseres ehemaligen Landesgartenschaugeländes, welches sich am Ufer der Enz erstreckt, darstellen: Bild 5 Bürgergarten Dieses Gelände wurde bis 1989 angelegt und ist heute in die Bereiche -Bürgergarten (Staudengarten)20 144 m2-Feuchtbereich 5 800 m2 -Spielbereich 8 700 m2 gegliedert. Im folgenden möchte ich auf den größten und sicher auch attraktivsten Bereich, den Bürgergarten, eingehen. Der Bürgergarten ist
reich an verschiedenen Nutzungsarten (Rasen 7020,4 m2, Wiese 5527.9 m2, Stauden 2271,8 m2, Bodendecker 1337,9 m2, Sträucher 3387,3 m2, Wechselflor 171,2 m2, Solitärbäume, Kübelpflanzen, Tiere, Wasser). Wie ich bereits erwähnte,
führen wir seit 1978 eine systematische Erfassung aller Arbeitsleistungen durch. Seit Existenz des Bürgergartens haben wir daher die Pflegeaufwände festgehalten, allerdings nur als Summenzahl in Stunden und Kosten pro Jahr. Eine
weitere Aufgliederung war bisher, wie bereits erwähnt, aus Aufwandsgründen nicht möglich. Mit dem Jahr 1997 hat sich dies erstmals geändert. Wie Sie sehen, stehen uns jetzt erstmals detailliert aufgegliederte Zahlen aus dem GIS
und der dort integrierten Kosten-Leistungsrechnung zur Verfügung. Bild 6 InfraGrün - Bilanzzahlen der Arbeitszeit/Arbeitskosten 1997 Diese Zahlen aus der Bilanz sind für unsere interne Planung sehr wichtig.Aber Vorsicht, keine vorschnellen Urteile und keine Verallgemeinerungen dieser Werte für die
Gesamtstadt. Zu differenziert sind die Leistungen im Bürgergarten, in dem verschiedene Nutzungsflächen eng verflochten existieren. Wir können zwar bereits Handlungsschwerpunkte erkennen, aber wir wollen diese differenzierten Zahlen
erst einmal über einen gewissen Zeitraum beobachten, ehe wir auf dieser Basis Umstrukturierungsmaßnahmen beschließen, Kulturen austauschen oder andere Arbeitsmethoden wählen. Die Ergebnisunterlagen aus dem GIS sind somit
Dokumente zum Nachweis unserer kostenbewußten Arbeit auch gegenüber der Finanzverwaltung und unverzichtbare Basis für die Bürgerauskunft. 5.Resümee Die bei uns schon vorhandenen Methoden zur effektiven Bewirtschaftung
unseres Grüns wurden durch das GIS mittels der Bilanzierungsmechanismen unterstützt. Ergebnisse können schneller analysierbar aufbereitet und Dokumente in moderner Form unter MS Office bereitgestellt werden. Wir sind
zeitnaher und schneller in unseren Analysen geworden und können gezielte Ergebnisdiskussionen führen. Durch die Schnittstelle zum Bauhofprogramm wurde ein erhebliches Stück Annäherung, vor allem im organisatorischen Bereich
zwischen Bauhof und Stadtgärtnerei erreicht. Die Arbeitsbesprechungen mit den Vorarbeitern (und bei Vergaben auch mit den Pflegebetrieben) zur Pflegeplanung sind zügiger und mit klar dokumentierten Unterlagen durchführbar.
Informationsverluste sind stark reduziert worden bzw. können ganz vermieden werden. In der erste Hälfte dieses Jahres wird die Umstellung auf das Windows NT-Betriebssystem und damit auch die Ablösung des GIS GREENBOX durch dessen
Nachfolger InfraGrün vollzogen. Im Bereich der Baumkontrolle werden wir auf der Basis von Palmtops eine Windows-CE gestützte Vorort-Datenerfassung erproben, die eine einfache Baumidentifizierung und Schadenerfassung sowie eine
mediale Schadendokumentation erlauben soll. |